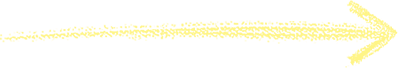Der faustische Mensch ist mit seinem Leben nicht zufrieden, beschränkt. Faust wurde nicht nur von Goethe behandelt. Früher war die Faust-Legende z.B. in:
- "Teofilus Legende" (9. Jh.), eine Nonne Roswitha von Gandersheim. Teofilus bittet den Teufel um Hilfe, es kommt zu dem Vertrag - alles für die Seele (für 20Jahre).
- Das Thema wurde auch von G. E. Lessing betrachtet.
Dann kommt Goethes "Faust". Der Name des Teufels - Mephistopheles. Der Vertrag - eine sehr klare Entscheidung (3x "Herein"). Die Bedingung lautet: Faust muss glücklich sein (V. 1699-1702)
"Werd' ich zum Augeblicke sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen
Dann will ich gern zugrunde gehen!"
Wenn es dem Teufel gelingt, kann er Faustus Seele nehmen. Die Sache ist unterschieden, ob Faust seine Seele dem Teufel gibt oder nein.
VORSPIEL AUF DEM THEATER
Nur mittelbar hängt es mit dem "Faust" zusammen. Nur 3 Figuren:
- Direktor
- Theaterdichter
- Lustige Person (Komödiant, Schauspieler)
Prinzipiell organisierte Theateraufführungen. Konflikt zwischen der Sphäre der Kunst u. der Sphäre des praktischen Denkens. Dem Dichter geht es um die Kunst, dem Direktor um Erfolg (Stücke, die dem Publikum gefallen). Das Publikum wünscht sich nicht immer große Stücke (das höchste Niveau). Der Schauspieler versucht zwischen den beiden zu schlichten Das Publikum will, dass viel geschieht, mehr Unterhaltung. Der Direktor entscheidet, was wird gespielt - etwas Leichteres, Spannendes - "Vom Himmel durch die Welt zur Hölle" (V.242)
PROLOG IM HIMMEL
Im Text handelt es sich darum, wer eigentlich die Wette gewonnen hat. Das Prolog im Himmel enthält einen wichtigen Schlüssel zur Lösung der Frage.
DER TRAGÖDIE ERSTER TEIL
Faust' Wünsche:
- Jugend
- Möglichkeit diejenigen zu sehen, die er nicht mag.
- Große Liebe - er will Gretchen (Margarete) für sich gewinnen, es ist nicht so einfach - sie ist ein frommes Mädchen, traditionell erzogen. Der Bruder Gretchens wird getötet, die Mutter stirbt auch. Schließlich liebte Gretchen den Faust.
Aber dem Faust reicht es nicht, er will noch mehr, noch was anderes. Gretchen leidet, sie wird zu Kindesmörderin. Im Kerker (Gefängnis) wartet sie auf Tod. Gretchen betet an die Mutter Gottes, sie ist verzweifelt, aber mit dem Leben versöhnt. In diesem Moment erscheinen Faust u. Mephistopheles. Sie wollen Gretchen befreien u. ein neues Leben gewinnen. Gretchen will es aber nicht mehr. Mephistopheles u. Faust entfernen sich. Sie ruft noch "Heinrich" u. stirbt langsam; Ende des 1. Teils. Gretchen bemerkt immer jemanden anderen in der Nähe von Faust. Sie fragt ihn, was er von der Religion hält. Die Frage Gretchens ist nicht leicht, nicht sofort zu beantworten. Faust will die Frage nicht beantworten; keine direkte Antwort.
DER TRAGÖDIE ZWEITER TEIL
Der 2. Teil unterscheidet sich von dem 1. Teil. In diesem Teil Faust geht aus der Sphäre seiner eigenen Probleme hinaus. Seine Wünsche betreffen nicht mehr seine Jugend oder Liebe. Wir sehen ihn auch in der Sphäre des öffentlichen Lebens; in der Welt Finanzen, Politik, Technik.
Homunkulus - die Idee eines künstlichen Menschen - das zeigt, wie sehr Goethe seiner Zeit im Voraus war. Gegen den Schluss kommt Faust auf eine neue Idee. Er denkt daran, dass die Menschen im ganz engen Raum leben müssen. Er hat eine neue Aufgabe für Mephistopheles - der Teufel soll dabei behilflich sein, dass ein bisschen Land dem Meer …….. wird. Kampf des Menschen mit den Wellen. Dieses Motiv wird oft zu banal gedeutet, in bestimmten Epochen sehr primitiv interpretiert (auf freiem Grund mit freiem Volk). Faust tut es nicht seinetwegen, er braucht dieses Stück vom Land überhaupt nicht. Ein kleines Haus steht im Wege, dort wohnt ein uraltes Ehepaar (Philemon u. Baucius - aus der griechischen Mythologie). Sie haben das ganze Leben zusammengelebt u. wollen auch zusammen sterben. Mephistopheles sagt ihnen, sie müssen weg, weil das Haus zerstört werden muss. Sie weigern sich, sie wollen dort bis zum Schluss bleiben. Das Häuschen wird zerstört - das zeugt von Goethes Realismus. Im 20. Jh. werden viele Vorhaben, große Bauten, gigantische Projekte realisiert aber nicht überhaupt ohne Opfer (im 19. Jh. - die französische Revolution hat viel verbessert doch es gab auch Opfer dabei).
3. Akt - Symbolik. Faust verlangt von Mephistopheles die schönste Frau aller Zeiten - Helena (gr. Mythologie - der trojanische Krieg wurde um sie geführt). Es ist aber eine schwierige Aufgabe, weil Helena seit langem in Unterwelt lebt. Mephistopheles bringt Helena zum Schloss, wo Faust residiert. Die Verbindung Faust u. Helenas - Verbindung der antischen Kultur mit der modernen Kultur. Aus dieser Verbindung wird ein merkwürdiges Kind geboren - es kann sofort laufen, tanzen, singen. Es heißt Euphorion, es ist ein lebhaftes Kind, es will sofort auf den Berg hinaufklettern. Helena warnt ihn, doch er klettert hinauf, stürzt u. kommt ums Leben. Eine Figur aus Goethes eigenen Erfahrungen. G. Byron (hat Liebe zur Freiheit mit Tat bestätigte, Byron fuhr nach Griechenland, erkrankte an Fieber u. starb). Der Tod eines sehr begabten u. bedeutenden Dichters war der Grund. Helena-Akt: In der Begleitung Helenas (sie kommt in einer großen Begleitung) gibt es auch Mephistopheles, aber in einer ganz anderen Rolle. In diesem Akt - eine positive Funktion des Teufels (er repräsentiert Poesie nach dem Tode Euphorions). Helena verschwindet, Faust ist wieder allein.
Fast in jeder Szene können wir etwas finden, was von der Bedeutung des Werkes zeugt. Goethe berührte fast alle wichtigen Probleme der Zeit.