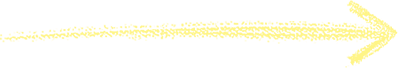1.) Die Identitätshypothese (Natural Order Hypothesis)
Diese Hypothese besagt, dass wir die Fremdsprache auf dem gleiche Wege wie die Erstsprache erlernt werden sollte. Identisch heißt hier induktiv.
2) Input - Hypothese
Input bedeutet auf Englisch etwas, was eingegeben wird, also die Eingabe.
Die Input-Hypothese besagt Folgendes: Die Eingabe von einem sprachlichen Material ist für den Lerner notwendig. Der Lehrer muss also eine bestimmte Menge von sprachlichen Daten in das Gedächtnis des Lerners eingeben. Der Lehrer gibt also ein und der Lerner speichert das Material im Gedächtnis und er muss den Input verarbeiten. Bevor der Lerner zu kommunizieren anfängt muss er Bestimmtes auswendig lernen.
Diese Hypothese hilft uns aber eigentlich nicht, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man den Unterricht ohne Input nicht machen kann.
3)Des Affektiven Filters - Hypothese
Diese Hypothese besagt, dass die Lernprozesse des menschlichen Gehirns auch von psychischen Prozessen abhängig sind. Die Lerner, die sich für die Fremdsprachen interessieren, lernen besser und schneller, als diese Lerner, die kein Interesse am Fremdsprachenlernen haben. Das ist also eine banale Hypothese. Wenn ich etwas tue, was ich tun mag, dann tue ich es umso lieber und mit größerem Erfolg.
Der affektive Filter kann z.B. durch den Stress eingeschaltet werden. Durch den Stress verliert der Mensch die Fähigkeit, das Gelernte abzurufen und praktisch umzusetzen. Der Stress blockiert die Zufuhr, das Abrufen und die Umsetzung des Wissens und des Könnens. Das einzelne Mittel gegen das Einschalten des affektiven Filters im Unterricht ist die Motivation (das Bewusstsein des Nutzens des FSL in der Zukunft).
Die Hypothese des affektiven Filters betrifft sowohl alle Fächer in der Schule als auch alle Bereiche im Leben - deshalb ist sie trivial.
4) Die Monitorhypothese:
besagt, dass der Lerner beim Sprechen(weniger beim Schreiben) lediglich zu einer Kontrolle der eigenen Leistung ex post fähig ist. Ex post heißt nach der Aussage, wen er einen Fehler begangen hat - im Gegensatz zu ex ante, was die Kontrolle vor der Aussage heißt.
Wenn die Kontrolle ex post verläuft, bedeutet es, dass der Sprecher die Regel nicht abgerufen hat bevor er die Phrase gebildet hat, weil wenn er die Regel abgerufen hätte, hätte er diesen Fehler nicht begangen. Der Sprecher kann nicht kontrollieren, dass er Fehler begangen hat, bevor er das sprach, weil die sprachliche Kommunikation keiner mentalen Kontrolle unterliegt.
Diese Hypothese kann man aber anzweifeln, wenn man die Fortgeschrittenen in Betracht zieht. Es fällt auf, dass die Fortgeschrittenen beim Sprechen zwischen bestimmten Wörter Pausen machen- z.B. was für Artikel soll es sein, welche Wortfolge, Deklination, usw…
Wen der fortgeschrittene Lerner also der Schwierigkeit bewusst ist und eine Regel abberuft, dann bedeutet es, dass er den Verlauf seiner Aussage ex ante kontrolliert.